Verbrühungsschutz Welche Pflichten treffen Planer und Ausführende
Das Thema Verkehrssicherungspflicht des Betreibers einer gebäudeinternen Trinkwasserinstallation spielt in der juristischen Praxis zunehmend eine bedeutendere Rolle. Ein Sonderfall dieser Verkehrssicherungspflicht ist die Frage, in welchem Umfang der Betreiber die Nutzer einer Trinkwasserinstallation vor Verbrühungen zu schützen hat. In der einschlägigen Rechtsprechung haben sich bisher einige wichtige Entscheidungen mit dieser Problematik befasst. (OLG Stuttgart, Urteil 5. August 1998 - 4 U 73/97; OLG Oldenburg, Urteil 10. August 2001 - 6 U 43/01 -; OLG München, Urteil 23. Februar 2006 - 8 U 4897/05 -; LG Würzburg, Urteil 17. November 2009 - 24. O. 1642/09).
Autor: Thomas Herrig, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
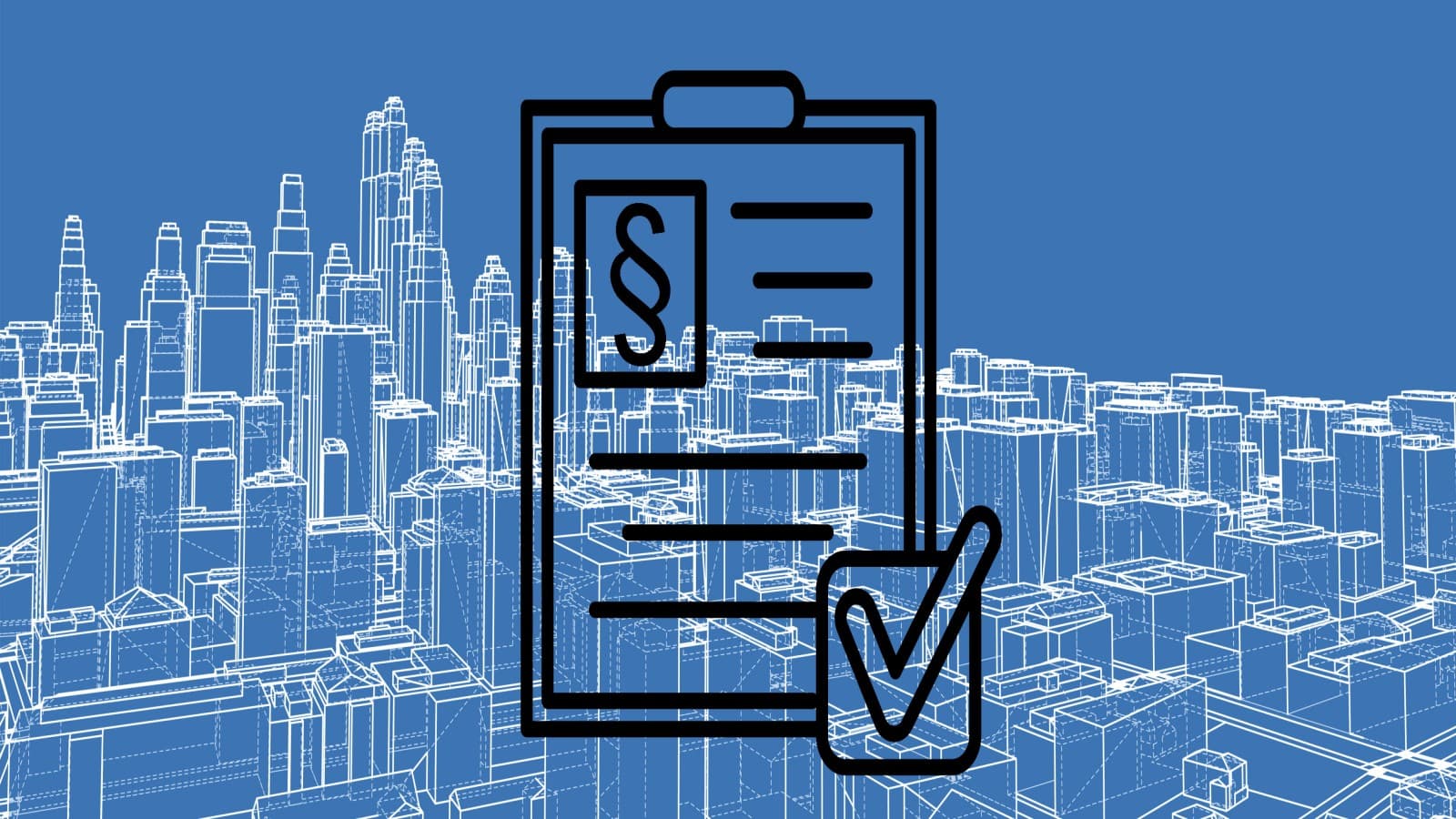
Sowohl für die Planungspraxis als auch für den Bereich der ausführenden Gewerke hat sich im Nachlauf derartiger Entscheidungen immer die Frage gestellt, ob Verbrühungsschutz im Bereich der Planung oder Ausführung grundsätzlich vorzusehen ist oder ob dieses Thema - da die einschlägigen normativen Regelungen nur empfehlenden Charakter haben - dem Betreiber im Rahmen der Erfüllung seiner Verkehrssicherungspflicht, die er seinem Nutzer schuldet, überlassen werden kann.
Da sich das höchste deutsche Gericht in Zivilsachen, der Bundesgerichtshof, in einer Entscheidung vom 22.08.2019 (BGH, Urteil 22.08.2019 - III ZR 113/18) mit diesem Thema ausführlich beschäftigt und in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung der zugrunde zu legenden normativen Regelungen festgelegt hat, soll nachfolgend dargestellt werden, wie mit dem Thema Verbrühungsschutz auf der Grundlage der neuen höchstrichterlichen Rechtsprechung umzugehen ist.
Die Entscheidung des BGH
Die aktuelle Rechtsprechung des BGH enthält Grundsätze, die im Bereich Planung und Ausführung zu beachten sind und mit dem potentiellen Auftraggeber kommuniziert werden müssen.
Leitzsätze
In der hier in Rede stehenden Entscheidung des BGH ging es um die Frage, wie sich der Umfang der Verkehrssicherungspflicht des Betreibers im Hinblick auf den zu gewährleistenden Verbrühungsschutz gegenüber Nutzern gestaltet. Der BGH hat hier festgestellt, dass der Betreiber zum Schutz der körperlichen Unversehrtheit der Nutzer der Trinkwasserinstallation verpflichtet sein soll, diese vor einer in einer DIN-Norm beschriebenen Gefahrenlage dann zu schützen, wenn diese selbst aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Einschränkung dazu nicht in der Lage sind.
Diese Verkehrssicherungspflicht kann der Betreiber nur dann erfüllen, wenn er entweder die Empfehlungen der DIN-Norm umsetzt oder aber die erforderliche Sicherheit gegenüber der dieser Norm zugrunde liegenden Gefahr auf andere Weise gewährleistet, um Schäden für den Nutzer der Trinkwasserinstallation zu vermeiden (BGH, a.a.O.).
Die grundsätzlichen, für die Praxis bedeutsamen Aussagen des BGH soll nachfolgend zusammengefasst werden:

1. Leitsatz
Soweit im Hinblick auf eine bestimmte Gefahrenlage - hier geht es um die körperliche Unversehrtheit der Nutzer - technische Regelungen wie insbesondere DIN-Normen bestehen, können diese im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung zur Konkretisierung des Umfanges der Verkehrssicherungspflichten des Betreibers mit herangezogen werden.
2. Leitsatz
DIN-Normen tragen die widerlegliche Vermutung in sich, die aktuell geltenden allgemeinen anerkannten Regeln der Technik wiederzugeben.
3. Leitsatz
DIN-Normen sind daher zur Bestimmung des nach der Verkehrsauffassung Gebotenen in besonderer Weise geeignet und können regelmäßig zur Feststellung von Inhalt und Umfang bestehender Verkehrssicherungspflichten herangezogen werden.
4. Leitsatz
Auch außerhalb ihres unmittelbaren - technischen - Anwendungsbereiches kommen DIN-Normen als Maßstab für verkehrsgerechtes Verhalten in Betracht, soweit Gefahren betroffen sind, vor denen sie schützen sollen.
5. Leitsatz
DIN-Normen enthalten im Allgemeinen keine abschließenden Verhaltensanforderungen. Deshalb darf sich der Verkehrssicherungspflichtige nicht darauf beschränken, die Empfehlung technischer Normen unbesehen umzusetzen. Vielmehr hat er die zur Schadenabwehr erforderlichen Maßnahmen anhand der Umstände des Einzelfalles eigenverantwortlich zu treffen.
6. Leitsatz
Die Zumutbarkeit von Sicherungsvorkehrungen (Umfang der Verkehrssicherungspflicht) ist dabei unter Abwägung der Wahrscheinlichkeit der Gefahrverwirklichung, der Gewichtigkeit möglicher Schadensfolgen und des mit etwaigen Sicherungsvorkehrungen verbundenen Aufwands zu bestimmen.
Diese aus den Leitsätzen des BGH herzuleitenden Abwägungsmaßstäbe sollte der Praktiker wenigstens ansatzweise bei Planung und Ausführung berücksichtigen. Doch dazu später mehr. Schließlich ist noch auf die konkreten Praxishinweise einzugehen, die die oben zitierte BGH-Entscheidung enthält:
Praxishinweise
1. Praxishinweis
Die bloße Existenz einer DIN-Norm kann für das Bestehen eines zu vemeidenden Risikos sprechen, dem durch Sicherheitsvorkehrungen zu begegnen ist.
2. Praxishinweis
Um einem durch eine DIN-Norm konkretisierten Risiko im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu entsprechen, hat der Betreiber entweder dafür zu sorgen, dass die Empfehlungen der DIN-Norm umgesetzt werden oder aber die erforderliche Sicherheit gegenüber der dieser Norm zugrunde liegenden Gefahr auf andere Weise zu gewährleisten, um Schäden der Nutzer zu vermeiden.
Anmerkung: Gerade diese Frage hat der Planer im Zuge der Erfüllung der Leistungsphase 1 der HOAI (Grundlagenermittlung) mit dem späteren Betreiber zu erörtern. Nimmt der Ausführende selbst Planungsaufgaben wahr, obliegt ihm diese Aufgabe.
3. Praxishinweis
Schließlich äußert sich der BGH sogar noch sehr deutlich zur Frage eines etwaigen Bestandsschutzes:
Das Maß der gebotenen Sicherheitsvorkehrungen bei einer technischen Anlage richtet sich nicht ausschließlich nach den zum Zeitpunkt ihrer Errichtung bestehenden Erkenntnissen und dem damaligen Stand der allgemein anerkannten Regeln der Technik. Vielmehr ist es eine Frage des Einzelfalles, ob aus sachkundiger Sicht eine konkrete Gefahr besteht, dass durch die technische Anlage ohne Nachrüstung Rechtsgüter anderer verletzt werden können. Je größer die Gefahr und je schwerwiegender die im Falle ihrer Verwirklichung drohenden Folgen sind (Leben, Körper, Gesundheitsschäden), umso eher kann die nachträgliche Umsetzung neuerer Sicherheitsstandards geboten sein.
Damit sollten sich Planende und Ausführende vor Augen halten, dass bei Planung des Umbaues oder der Ausführung des Umbaues von Bestandsanlagen eine entsprechende Hinweispflicht besteht. Man hat also in diesem Zusammenhang mit dem Auftraggeber zu erörtern, wie er seiner Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des zu gewährleistenden Verbrühungsschutzes nachkommen soll.
Normative Anforderungen
Zu Recht stellt der Bundesgerichtshof fest, dass die in den einschlägigen Normen enthaltenen Anforderungen zum Verbrühungsschutz empfehlenden Charakter haben. Dies lässt sich auch aus einer Betrachtung der einschlägigen Regelwerke eindeutig herleiten.
DIN EN 806-2
Einschlägig ist hier der Punkt 9.3.2 “Vermeiden von Verbrühungen“ der DIN EN 806-2 (2005 - 06 Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen - Teil 2 - Planung). Die entsprechende Formulierung lautet: “Anlagen für erwärmtes Trinkwasser sind so zu gestalten, ... , sollten zur Vermeidung des Risikos von Verbrühungen thermostatische Mischventile oder Minusbatterien mit Begrenzung der oberen Temperatur eingesetzt werden. Empfohlen wird eine höchste Temperatur von 43 Grad Celsius. Bei Duschanlagen usw. in Kindergärten und speziellen Bereichen von Pflegeheimen sollte sichergestellt werden, dass die Temperatur 38 Grad Celsius nicht übersteigen kann.
DIN 1988-200
In der DIN 1988-200 (DIN 1988-200: 2012-05 “Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen - Teil 200 - Installation Typ A (geschlossenes System) - Planung, Bauteile, Apparate, Werkstoffe; Technische Regel des DVGW“) findet sich unter dem Punkt 9.3.1. folgende Formulierung: “Es dürfen nur Entnahmearmaturen mit Einzelsicherungen und, wo gefordert, Verbrühungsschutz eingesetzt werden.“
DVGW - Arbeitsblatt W 551
Das DVGW-Arbeitsblatt W 551 (DVGW-Arbeitsblatt W 551: 2004-04 “Trinkwassererwärmungs- und Trinkwasserleitungsanlagen - Technische Maßnahmen zur Verminderung des Legionellenwachstums - Planung, Errichtung, Betrieb und Sanierung von Trinkwasserinstallationen“). erwähnt das Thema Verbrühungsschutz nur am Rande.
Unter Ziffer 5.5.1 Entnahmearmaturen heißt es wörtlich: “Es sollen nur Entnahmearmaturen mit Einzelsicherungen und, wo gefordert, Verbrühungsschutz eingesetzt werden“. Unter Ziffer 8.3.3.1 Entnahmearmaturen trifft man eine wortgleiche Formulierung an, die jedoch auf den Zusatz: ... “wo gefordert“ ... verzichtet. Insoweit darf man davon ausgehen, dass das DVGW-Arbeitsblatt W 551 keine eigenen Anforderungen zum Thema Verbrühungsschutz aufstellt.
VDI-Richtlinie 6000 Blatt 5
Die VDI-Richtlinie 6000 Blatt 5 (VDI-Richtlinie 6000 - Blatt 5: 2004-11 “Ausstattung von und mit Sanitärräumen - Seniorenwohnungen, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime“) stellt keine Anforderungen zum Thema Verbrühungsschutz auf.
Die Bedeutung von Festlegungen in Normen oder die DIN 820
Für den Praktiker ist es wichtig, feststellen zu können, ob Vorgaben aus technischen Normen verbindlichen oder nur empfehlenden Charakter haben. Maßstab für diese Feststellung ist die DIN 820-2 (DIN 820-2: 2012-12 “Normungsarbeit - Teil 2: Gestaltung von Dokumenten (ISO/IEC-Direktiven - Teil 2: 2011, modifiziert); dreisprachige Fassung (CEN-CENELC - Geschäftsordnung - Teil 3: 2011“. Hier finden sich in Anhang H (normativ) Verbformen zur Formulierung von Festlegungen in technischen Normen.
Anhand dieser Vorgaben ist zu prüfen, ob die hier einschlägigen technischen Regeln in den Normen verbindlichen oder nur empfehlenden Charakter haben.
Normative Anforderung - „muss“
Die Verbformen aus der sogenannten “Tabelle H.1 - Anforderung“ des Normanhangs müssen für Anforderungen angewendet werden, die, um die Einhaltung des Dokumentes zu sichern, verbindlich, d.h. ohne Abweichung eingehalten werden müssen. In diesem Falle ist das Verb “muss“ zu verwenden. Dabei dürfen gleichbedeutende Ausdrücke für die Anwendung in Ausnahmefällen Verwendung finden, wie z.B.: “Es ist erforderlich, dass“ oder “Es ist notwendig“. Außerdem darf auch das Verb “darf nicht“ mit gleichbedeutenden Ausdrücken verwendet werden. (Tabelle H.1).
Nach dieser Definition ist zu erkennen, dass die Formulierung in DIN EN 806-2 (1. Halbsatz: Anlagen für erwärmtes Trinkwasser sind so zu gestalten, ...“) die Pluralform aus den gleichbedeutenden Ausdrücken der Tabelle H.1 der DIN 820-2 verwendet. Damit wäre zunächst einmal die Verbindlichkeit der hier in Rede stehenden Regelung festgelegt. Der 2. Halbsatz lautet dann: “..., dass das Risiko von Verbrühungen gering ist“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass eine Risikominimierung im Hinblick auf Verbrühungen zu erfolgen hat. Ein vollständiger Ausschluss ist damit nicht vorgegeben.
Normative Empfehlung - „sollte"
In den folgenden Formulierungen für besondere Einrichtungen ist die Festlegung wie folgt formuliert: “... sollten zur Verminderung des Risikos von Verbrühungen ...“ , “empfohlen wird ...“, “... sollte sichergestellt werden ...“.
Der Begriff “sollte“ findet sich in Tabelle H.2, Empfehlung der DIN 820-2. Diese Verbformeln müssen angewendet werden, wenn von mehreren Möglichkeiten eine besonderes empfohlen wird, ohne andere Möglichkeiten zu erwähnen oder auszuschließen, oder wenn eine bestimmte Handlungsweise vorzuziehen ist, aber nicht unbedingt gefordert wird. Auch muss die Verbform Anwendung finden, wenn (in der negativen Form) von einer bestimmten Möglichkeit oder Handlungsweise abgeraten wird, diese jedoch nicht verboten ist. Die einschlägige Verbform lautet: “sollte“. Gleichbedeutend ist der Begriff: “es wird empfohlen, dass ...“ (Tabelle H.2).
Durch diese Definition kann somit davon ausgegangen werden, dass die weiteren Festlegungen in DIN EN 806-2 unter Ziffer 9.3.2. nur einen Empfehlungscharakter haben und damit die Möglichkeit eröffnet ist, Verbrühungsschutz auch auf andere Art und Weise sicherzustellen. Verbindlich ist nur der erste Satz unter 9.3.2. dahingehend, dass eine Risikoverminderung im Hinblick auf Verbrühungen zu erfolgen hat. Ein vollständiger Risikoausschluss ist nicht gefordert. Die DIN 1988-200 stellt unter 9.3.1. keine eigene Anforderung hinsichtlich des Verbrühungsschutzes auf, sondern bezieht sich darauf, dass, wo Verbrühungsschutz anderweitig gefordert ist, nur entsprechende Entnahmearmaturen eingesetzt werden dürfen.
Bisherige Rechtsprechung
Die bisher zu der Thematik ergangene Rechtsprechung ist sich dahingehend einig, dass das Schaffen von Verbrühungsschutz Sache des Betreibers der Trinkwasserinstallation im Rahmen der ihm insoweit obliegenden Verkehrssicherungspflicht ist (OLG München, a.a.O., OLG Hamm a.a.O.). Wie der Bundesgerichtshof in der aktuell zitierten Entscheidung geht auch die gesamte bisherige Rechtsprechung davon aus, dass die technischen Regelwerke eine Risikominimierung zum Ziel haben und zu den weiteren Vorgaben auch nur Empfehlungscharakter besitzen. Es sei Sache des Betreibers der Trinkwasserinstallation, sicherzustellen, dass Verbrühungsschutz gewährleistet ist. Entweder auf technischem Wege oder aber durch Übernahme der Aufsicht, wenn gefährdete Personen die Trinkwasserinstallation nutzen.
Pflichten der Baubeteiligten
Nicht zuletzt auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes haben Planer und ggf. auch die ausführenden Gewerke die Verpflichtung im Falle außergewöhnlicher Nutzungssituationen - planende - Vorkehrungen zu treffen, um das Risiko aus der Nutzung des Warmwasserbereiches so klein wie möglich gehalten wird.
Die diesbezüglichen technischen Vorgaben (Normen) sind mit dem Auftraggeber und dem späteren Betreiber (soweit bekannt), der auch die Verkehrssicherungspflicht nach Abnahme übernimmt, zu erörtern. In diesem Zusammenhang ist auf die aktuelle Rechtsprechung hinzuweisen. D.h. für die Praxis, dass bei außergewöhnlichen Nutzungssituationen (Kindergärten, Schulen, Seniorenwohnanlagen u.ä.) der potentielle Betreiber darüber aufzuklären und mit diesem abzustimmen ist, wie der aus einer möglichen Verbrühung herrührenden Gefahrenlage begegnet werden kann. Mithin ist von dem Planer bzw. dem ausführenden Gewerk mit dem Betreiber zu klären, ob die Empfehlungen der einschlägigen DIN-Normen umzusetzen sind oder aber die erforderliche Sicherheit gegenüber der dieser Norm zugrunde liegenden Gefahr auf anderes Weise gewährleistet ist, um Schäden für die Nutzer zu vermeiden.
Diese Verpflichtung trifft den TGA-Planer schon in der Leistungsphase 1 des § 53 Abs. 1 HOAI. Bereits in diesem frühen Stadium muss der TGA-Planer den Auftraggeber, ggf. auch den Objektplaner, darauf hinweisen, dass dem verkehrssicheren und bestimmungsgemäßen Betrieb einer Trinkwasserinstallation im Rahmen der späteren Gebäudenutzung eine besondere Bedeutung zukommt. Dazu hat der Planer das Thema Verbrühungsschutz auf jeden Fall dann anzusprechen, wenn die geplante Einrichtung später Personen beherbergt, die unter Umständen nicht in der Lage sind, sich vor den Gefahren von heißem Wasser selbst zu schützen. Handelt es sich hingegen um Personen, die in der Lage sind, sich selbst vor den Gefahren von zu heißem bzw. kochenden Wasser wie jede gesunde, dem Kleinkindalter entwachsene Person zu schützen, wird das Thema Verbrühungsschutz eher nur untergeordnete Bedeutung haben. Die entsprechenden Planerpflichten sind im Zusammenhang mit den Planungsregelungen aus VDI 6023, 4.2. sowie DIN 1988-200, Ziffer 8.3 zu sehen. Hiernach ist eine enge Abstimmung zwischen Fachingenieur, Auftraggeber und möglichem späteren Betreiber gefordert.
Eindeutig ist also, dass der Fachplaner (ggf. auch das ausführende Gewerk) mit dem Auftraggeber zu klären hat, wie endständig Verbrühungsschutz unter besonderen Nutzungssituationen hergestellt wird. Er muss in diesem Zusammenhang eine bautechnische und eine betriebstechnische Alternative vorschlagen, die er mit dem Auftraggeber bzw. späteren Betreiber zu besprechen hat. Es ist dann Sache des Auftraggebers bzw. Betreibers, darüber zu entscheiden, ob allein aufgrund bautechnischer Maßnahmen Verbrühungsschutz hergestellt ist oder der Betreiber selbst im Rahmen der späteren Nutzung betriebstechnisch z.B. durch das Abstellen von entsprechendem Personal für die Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht bezüglich des Verbrühungsschutzes selbst sorgt. Das Besprechungsergebnis sollte dokumentiert werden, damit im Falle einer Haftungsinanspruchnahme der Nachweis geführt werden kann, dass der Planer insoweit notwendige Aufklärungsarbeit geleistet hat.
Fazit
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes macht es also für Planer und ausführende Gewerke nochmals deutlich, dass der im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Betreibers zu gewährleistende Verbrühungsschutz besondere Bedeutung hat.
Auch wenn die normativen Regelungen nur empfehlenden Charakter haben, sollen sie, so der BGH, vor der in der DIN-Norm beschriebenen Gefahrenlage schützen. Dies kann entweder durch technische Maßnahmen sichergestellt werden oder aber der Betreiber hat die erforderliche Sicherheit gegenüber der den diskutierten Normen zugrunde liegenden Gefahr auf andere Weise zu gewährleisten. Im Ergebnis kann er dann also gefährdete Nutzer nur selbst beaufsichtigen oder dies durch fachkundige Personen vornehmen lassen. Verbrühungsschutz muss also gewährleistet sein.

Für Architekten, Planer und Architekturinteressierte Geberit eView Newsletter
Der Newsletter Geberit eView verschafft Ihnen Einblick in die spannendsten Referenzobjekte von Geberit.
Lassen Sie sich inspirieren von einzigartigen Projekten, informativen Experteninterviews und aktuellen Themen aus Architektur und Planung.
- Der Geberit eView Newsletter erscheint quartalsweise

Referenz-Magazin
Objekt-Magazin
